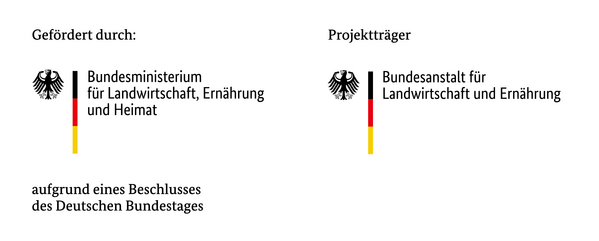Projekt PLANTEIN
MuD Proteine leguminosenfreier Anbaualternativen nicht tierischer Erzeugung in Nahrungsmitteln
© LWK NRW

Das Projekt Plantein soll landwirtschaftlichen Betrieben zukunftsfähige Einkommensalternativen im Markt pflanzlicher, proteinhaltiger Nahrungsmittel aufzeigen. Im Fokus steht die Extraktion bzw. Aufkonzentrierung von Proteinen aus Roherzeugnissen von sieben nicht-legumen Pflanzen:
Sonnenblume, Amaranth, Quinoa, Körnerhanf, Leinsamen, Chia und Raps.
Den Landwirtinnen und Landwirten soll eine maximale Mitwirkung an der Wertschöpfungskette ermöglicht werden.
Gefördert durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen des Chancenprogramm Höfe.
Demonstrationsbasierter Ansatz
Der Anbau der Kulturen findet in Zusammenarbeit mit Demonstrationsbetrieben statt. Nach der Ernte der Kulturen werden die Roherzeugnisse mittels einer marktreifen Verarbeitungsstraße aufbereitet. Im Lebensmittel-Technikum erfolgt dann eine Weiterverarbeitung bis hin zu einem verzehrfertigen Produkt. Die wechselseitige Abhängigkeit des landwirtschaftlichen Anbaus wie auch der technischen Weiterverarbeitung wird zentraler Gegenstand der Demonstrationen sein.
Ökonomische Perspektive
Über eine Ermittlung von Deckungsbeiträgen sowie eine Darstellung der Wirtschaftlichkeit veränderter Fruchtfolgen wird das ökonomische Potenzial der unterschiedlichen Kulturen bewertet. Vermarktungsoptionen werden erarbeitet und auf ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüft. Zusätzlich ermöglicht eine Untersuchung der entstehenden Treibhausgasemissionen eine Bewertung der Kulturen vor dem Hintergrund des Klimaschutzes.
Vermarktungsperspektiven
Die gewonnenen Erzeugnisse können entweder direkt vermarktet oder als Vorprodukt an die Lebensmittelindustrie geliefert werden. Für die Direktvermarktung müssen die Produkte der Kundschaft einen konkreten Mehrwert bieten. Die Belieferung der Lebensmittelindustrie bringt wiederum spezielle Qualitätsanforderungen mit sich, die es zu erreichen gilt. Beide Vermarktungswege bringen diverse Anforderungen mit sich, die bisher nicht Teil allgemeiner Qualitätsbetrachtungen landwirtschaftlicher Betriebe sind.
Qualität und Funktionalität
Über die Wahl der Anbaukulturen und der Kulturführung werden Proteingehalte und teilweise auch die Struktur beeinflusst. Die technische Aufbereitung (bspw. Druck, Temperatur, mechanische Beanspruchung) hat großen Einfluss auf die technofunktionalen Eigenschaften der Proteine und die Verwendungsoptionen in der Herstellung von Lebensmitteln, insbesondere von Fleischersatzprodukten.
Ziel
Obwohl der Markt einen großen Bedarf an möglichst gering verarbeiteten pflanzlichen Proteinerzeugnissen hat, ist das Wissen über die qualitativen Anforderungen in der landwirtschaftlichen Praxis kaum verbreitet, und ebenso ist die Chance, hochwertige Rohstoffe aus der Region zu beziehen, in der Lebensmittelbranche kaum beachtet. Markteintrittsbarrieren, die bisher eine große Hürde für landwirtschaftliche Betriebe darstellen, sollen identifiziert und Wege zu deren Überwindung aufgezeigt werden.
Dieses Modell- und Demonstrationsvorhaben soll Wissenslücken zwischen den Disziplinen der landwirtschaftlichen Urproduktion und der Lebensmittelindustrie durch Beteiligung von Institutionen mit vorhandenen Netzwerken (v. a. landwirtschaftliche Betriebe sowie Unternehmen der Lebensmittelverarbeitung) in beiden Disziplinen schließen und so eine Win-Win-Situation schaffen, die zur Sicherung des Einkommens landwirtschaftlicher Betriebe beiträgt.
Wissenstransfer und Vernetzung
Veranstaltungen wie Feldtage, Vorträge, Seminare Runde Tische und Exkursionen sollen sowohl Wissen vermittelt und ausgetauscht werden, als auch eine Vernetzung zwischen interessierten landwirtschaftlichen Betrieben sowie Akteuren und Stakeholdern des Sektors der alternativen Proteine ermöglichen.
Für Informationen zu aktuellen Veranstaltungen siehe Termine.
Plantein Veranstaltungs-Newsletter der Landwirtschaftskammer NRW
Termine
Grüne Woche 2026
20. - 21. Januar 2026

Das Projekt Plantein erwartet Sie am Stand der
Genussregion Ostwestfalen Lippe e.V.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Halle 5
Stand 148
DLG-Feldtage 2026
16. - 18. Juni 2026

Besuchen Sie das MuD Plantein auf den DLG Feldtagen!
Nähere Informationen folgen.
Team
© LWK NRW
Michaela Bock (LWK NRW), Sophia Balzar (LWK RLP), Prof. Susanne Struck (TH OWL), Carolina Penaranda (TH OWL)
Projektkoordination
Projektpartner
Kontakt LWK RLP

Sophia Balzar
Tel.: 0671 793 130
Kontaktformular >>>
Vorhabenbeschreibung